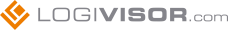Seit dem Amtsantritt von Donald Trump in seine zweite Präsidentschaft Anfang 2025 zieht wieder ein rauer Wind durch die internationalen Handelsbeziehungen. Mit neuen Zolldrohungen gegenüber China, der EU und insbesondere der deutschen Industrie setzt der US-Präsident auf eine „America First 2.0“-Strategie mit weitreichenden Folgen für Industrie, Logistik und Lieferketten. Was bedeutet das konkret für den Warenfluss, Standorte wie Hamburg und NRW – und für die Kontraktlogistik in Deutschland.
Handelskrieg Reloaded?
Trump hat in den ersten Monaten seiner zweiten Amtszeit erneut deutlich gemacht, dass er auf protektionistische Maßnahmen setzt: Strafzölle auf chinesische Elektroautos, Zolldrohungen gegenüber europäischen Maschinenbauern und pharmazeutischen Produkten, neue Auflagen im Energiesektor die Liste der Maßnahmen wächst. Zwar ist bislang noch nicht alles in geltendes Handelsrecht gegossen, doch allein die Ankündigungen haben spürbare Auswirkungen auf das Verhalten der Marktteilnehmer.
Verunsicherung in der Supply Chain
Was diese Politik vor allem erzeugt, ist Unsicherheit und die ist bekanntlich Gift für global vernetzte Lieferketten. Verlader zögern bei der Verschiffung in die USA, Logistikdienstleister berichten von gestoppten oder umgeleiteten Aufträgen, insbesondere aus Branchen wie Maschinenbau, Automotive oder Elektrotechnik.
Einige Reedereien haben laut Branchenmeldungen bereits begonnen, Container mit Zielhafen USA umzuleiten oder geplante Stopps zu stornieren. Der Grund: Die Gefahr kurzfristiger Zollanpassungen oder neuer bürokratischer Hürden ist zu hoch, um eine verlässliche Kosten- und Zeitplanung zu gewährleisten.
Auswirkungen auf Hamburg und NRW
Für deutsche Logistik-Hubs wie Hamburg oder Nordrhein-Westfalen sind die Auswirkungen greifbar. Hamburg, traditionell stark im Transatlantik-Geschäft, verliert temporär Volumen. In NRW, einem der industriellen Herzen Deutschlands, wächst die Sorge vor Exportbarrieren, insbesondere in exportstarken Branchen wie Chemie, Maschinenbau oder Automotive.
Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Kontraktlogistik: Temporäre Zwischenlagerung, flexible Re-Routing-Optionen, Verzollungsvorbereitung und kurzfristige Auftragsumstellungen werden zur neuen Normalität. Dienstleister mit resilienten Netzwerken und Erfahrung im Umgang mit internationalen Unsicherheiten sind nun besonders gefragt.
Wie Unternehmen jetzt reagieren können
Für Verlader und Logistikdienstleister ergeben sich aus der aktuellen Lage klare Handlungsfelder:
Netzwerke neu denken: Wer bislang stark auf den US-Markt fixiert war, sollte alternative Absatzmärkte (z. B. Südostasien oder Osteuropa) in den Blick nehmen.
Flexibilität sichern: Lagerflächen mit kurzfristig aktivierbaren Optionen, dynamische Transportlösungen und digitale Schnittstellen helfen, schneller zu reagieren.
Zusammenarbeit stärken: Enge Kooperation mit Logistikdienstleistern auf Augenhöhe – nicht nur als Lieferant, sondern als Sparringspartner – wird zum strategischen Vorteil.
Politik beobachten: Zollpolitik wird zur Risiko-Kategorie, die aktiv ins Supply-Chain-Risikomanagement integriert werden sollte.
Fazit
Die protektionistische Handelspolitik der USA unter Trump 2.0 stellt deutsche Industrie und Logistik erneut auf die Probe. Zwar sind noch viele Maßnahmen in der Schwebe, doch die Unsicherheit wirkt bereits heute. Wer seine Warenströme flexibel aufstellt, Zusammenarbeit intelligent organisiert und neue Wege in der Kontraktlogistik beschreitet, kann die Lage nicht nur abfedern – sondern als Chance für robustere Lieferketten nutzen.